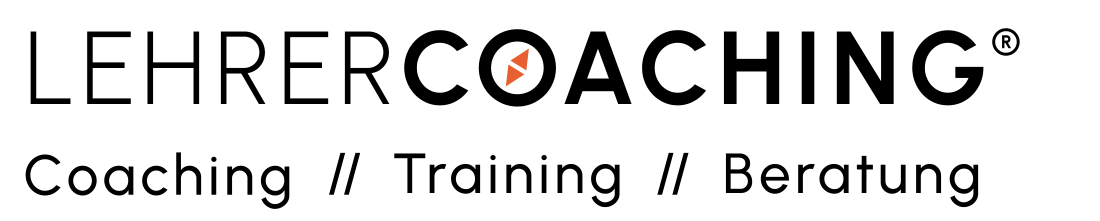Von außen: Sicherheit, Stabilität, Beamtenstatus.
Von innen: Erschöpfung, Sinnverlust, Entfremdung.
Das deutsche Schulsystem gilt als sicherer Arbeitgeber. Wer Lehrer wird, genießt Verbeamtung, Pensionsansprüche, Arbeitsplatzgarantie. Auf dem Papier klingt das nach Stabilität und Wertschätzung. Doch wer genau hinschaut, erkennt eine paradoxe Wahrheit:
Das System, das Stabilität verspricht, entzieht vielen Lehrkräften auf Dauer ihre Energie.
Darum ist das so:
1. Der Mensch als Funktionsträger
Der Alltag vieler Lehrerinnen und Lehrer ist von Strukturen geprägt, die kaum Freiheit zulassen.
Lehrpläne, Stundenraster, Verwaltungsroutinen und Prüfungsformate diktieren, was, wann und wie zu geschehen hat. Kreativität, Intuition und Beziehungsarbeit – eigentlich der Kern pädagogischer Wirksamkeit – geraten dabei oft unter Druck.
Lehrer werden zu „Funktionsträgern im Bildungsapparat“, gemessen an Noten, Evaluationen und Kennzahlen. Das System belohnt Konformität, nicht Inspiration. Wer Neues wagt, muss mit Skepsis rechnen – und das in einem Beruf, der eigentlich von Neugier und Mut leben sollte.
2. Verbeamtung: Sicherheit um den Preis der Selbstbestimmung
Die Verbeamtung schafft Sicherheit, aber sie hat ihren Preis. Sie bindet Lehrerinnen und Lehrer lebenslang an den Staat – und mit dieser Bindung gehen Abhängigkeiten einher. Kritik am System wird schnell als Illoyalität empfunden. Veränderungsgedanken stoßen auf strukturelle Trägheit. Beamte haben den Anweisungen und Plänen Folge zu leisten und sind einer dysfunktionalen Führungskultur ausgesetzt, welche Loyalität von ihnen verlangt.
Das erzeugt ein leises, aber wirksames Paradox: Lehrer sollen junge Menschen zu freien, denkenden Persönlichkeiten erziehen – während sie selbst in einem System leben, das Eigenverantwortung eher dämpft als stärkt. Verbeamtung kann zu einem psychologischen Käfig werden: Sie schützt vor äußerer Unsicherheit, erzeugt aber innere Erstarrung. Und es verwundert kaum, dass die Frühpensionierungsquote und auch die Krankenstände im Schuldienst überdurchschnittlich hoch sind.
Das System fordert Stabilität – und produziert zugleich Erschöpfung. Ein Teufelskreis, der nicht nur den Lehrkräften selbst, sondern letztlich auch dem Steuerzahler teuer zu stehen kommt.
3. Emotionale Erschöpfung und der Verlust des Sinns
Viele Lehrer berichten davon, dass sie den Sinn ihres Tuns kaum noch spüren. Zwischen Korrekturen, Konferenzen, Elterngesprächen und Verwaltungsaufgaben bleibt oft keine Zeit für das, was sie einmal in diesen Beruf gebracht hat: die Freude an Beziehung, Entwicklung und Inspiration.
Das System hat wenig Platz für Emotionen.
Lehrer, die erschöpft sind, bekommen keine Räume für echte Reflexion, sondern den Appell zur „Resilienz“. Die Botschaft von Kollegen und Schulleitung lautet: „Funktioniere weiter.“ So entsteht eine stille, systemische Entfremdung – von der eigenen Berufung, vom Menschen und letztlich von sich selbst.
4. Standardisierung
Die Fixierung auf Prüfungen, Noten und Vergleichbarkeit reduziert Bildung auf Messbarkeit Schüler werden zu Zahlen, Lehrer zu Verwaltern dieser Zahlen. Was nicht messbar ist – Empathie, Begeisterung, Werte, Beziehung – gilt als „nicht relevant“. Diese Logik entzieht dem Beruf seine Menschlichkeit. Denn echte Pädagogik lebt nicht von Kontrolle, sondern von Kontakt. Nicht von Leistungstabellen, sondern von Begegnung.
5. Zwischen Idealismus und Systemrealität
Viele Lehrerinnen und Lehrer starten mit Idealismus – und erleben dann die Ernüchterung, dass das System diesen Idealismus systematisch verschleißt. Das ist keine individuelle Schwäche, sondern eine strukturelle Tatsache. Das System ist so gebaut, dass es Stabilität über Entwicklung stellt, Anpassung über Authentizität, Loyalität über Lebendigkeit. Und genau hier beginnt die innere Erosion: Wer ständig funktionieren muss, verliert das Gefühl, ein Mensch zu sein, der wirken darf – nicht nur arbeiten muss.
6. Der Weg nach vorne
Die gute Nachricht: Menschlichkeit beginnt bei uns. Lehrercoaching, Supervision, Achtsamkeit und kollegiale Reflexion sind keine Luxusangebote, sondern Wege zurück zu einem lebendigen Berufsselbst. Wer sich wieder als Mensch erlebt – mit Gefühlen, Grenzen und Bedürfnissen – kann diese Menschlichkeit auch in den Klassenraum tragen. Das System wird sich nicht von heute auf morgen ändern. Aber es ist elementar, dass jeder Lehrer sich selbst und andere wahrnimmt, seine Bedürfnisse und Grenzen vertritt ohne dabei den Ethos zu verletzen und die Schüler aus den Augen zu verlieren.
Jeder Lehrer, der sich selbst wieder als Mensch und nicht als Funktion begreift, verändert seine Wirkung. Und damit das Klima in seiner Schule – Schritt für Schritt.
Fazit: Mensch zuerst
Das Schulsystem mag unpersönlich, starr und bürokratisch sein – doch Menschlichkeit ist ansteckend. Lehrer, die sich selbst ernst nehmen, die sich reflektieren, Grenzen setzen, sich Unterstützung holen und wieder Sinn finden, leisten den tiefsten Beitrag zur Bildung:
Sie zeigen, was es heißt, ein Mensch zu bleiben – mitten im System.
Hinweis: Dieser Beitrag spiegelt die persönliche Meinung der Autorin wider. Er versteht sich als Impuls zur Reflexion über Strukturen im Bildungswesen – nicht als Kritik an einzelnen Personen oder Behörden.
📚 Weiterführende Literatur und Quellenbasis
• Bauer, J. (2011): Schule der Empathie – Erziehung, Bildung und die Kraft der Beziehung. Hamburg: Hoffmann und Campe.
• Rothland, M. (Hrsg.) (2013): Beruf: Lehrer/Lehrerin – Ein Studienbuch. Beltz Verlag.
• Schaarschmidt, U. (2005): Halbtagsjobber? Psychische Gesundheit im Lehrerberuf – Analyse eines Mythos. Beltz.
• Hattie, J. (2009): Visible Learning – A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. Routledge.
• Terhart, E. (2011): Lehrerberuf und Professionalität. Waxmann Verlag.
• Hüther, G. (2016): Rettet das Spiel! Weil Leben mehr als Funktionieren ist. Hanser.